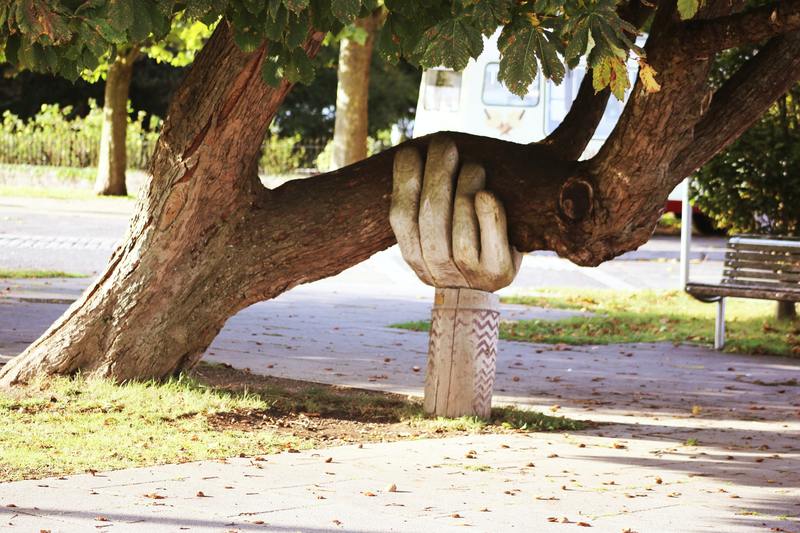 |
|
21.07.2025
Markus Schlagnitweit
Das Ende der Solidarität?
Spätestens seit Beginn seiner zweiten Amtszeit verstört und irritiert die – nennen wir sie einmal so – internationale Politik von US-Präsident Donald Trump weite Teile der politisch interessierten Öffentlichkeit. Sein Leitprinzip „Make America great again“ (MAGA) wirft viel von dem, was sich als „regelbasierte Weltordnung“ seit dem Ende des 2. Weltkriegs etabliert hat, einfach über den Haufen – angefangen von der universalen Gültigkeit der Menschenrechte über das Konzept der kollektiven Sicherheit, wie es in der Friedenscharta der UNO verankert ist, bis hin zu internationalen Verträgen, welche die Handelsbeziehungen zwischen den Staaten bzw. Wirtschaftsregionen regeln, die Klimapolitik vorantreiben oder die Zusammenarbeit etwa im Bereich der wissenschaftlichen Forschung, der Weltgesundheit oder der Entwicklungspolitik garantieren sollen.
Dabei wäre es eine Verkürzung, die gegenwärtige Erosion internationaler Ordnungsrahmen nur der aktuellen Trump-Administration anzulasten. Erstens haben die USA bereits früher, spätestens als sie nach dem Zusammenbruch des Sowjet-Imperiums eine Zeitlang nahezu konkurrenzlos die einzige wirtschaftliche, technologische aber v.a. militärische Super-Großmacht darstellten, eine regelbasierte Weltordnung nur nach Maßgabe ihrer eigenen Interessen akzeptiert bzw. sich an deren Beachtung beteiligt: Sie haben Kriege geführt (z.B. Irak), sie haben Menschenrechte verletzt (z.B. Guantanamo), sie haben die UNO mit der (zumindest Androhung der) Einstellung von Zahlungen unter Druck gesetzt, und sie anerkennen bis heute keine Urteile des Internationalen Strafgerichtshofs gegen eigene Staatsangehörige (z.B. in Hinblick auf Kriegsverbrechen eigener Militärs). Zweitens sind die USA beileibe nicht die einzigen, welche sich nicht an das internationale Regelwerk halten: Die UNO-Friedenscharta wird nicht nur durch manifeste militärische Aggressionen gegen andere souveräne Staaten verletzt (z.B. Russland vs. Ukraine), sondern bereits durch deren bloße Androhung (z.B. China vs. Taiwan); der Atomwaffensperrvertrag wurde seit seinem Bestehen bereits von mehreren Staaten gebrochen (Indien, Pakistan, Israel, Iran, N-Korea etc.); Menschenrechte werden weltweit und zumindest partiell sogar von demokratischen Rechtsstaaten verletzt; und die allerwenigsten Staaten der nördlichen Hemisphäre, darunter auch Österreich, haben ihre budgetären Selbstverpflichtungen im Rahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit jemals erfüllt, von Klimaabkommen und anderen ökologischen Rahmenverträgen ganz zu schweigen.
Man könnte angesichts eines solchen Befundes zum Schluss kommen, eine „regelbasierte Weltordnung“ wäre nichts als eine Fiktion bzw. ein wohlfeiler Gegenstand politischer Sonntagsreden und die internationalen Verträge und Codices das Papier nicht wert, auf dem sie niedergeschrieben sind. Das aber wäre meines Erachtens ein überschießender Fehlschluss. Einerseits können wir nicht sagen, wie unsere Welt aussähe ohne all diese Regelwerke, die immerhin den Niederschlag ernstzunehmender diplomatischer Bemühungen darstellen, ideologische, politische und/oder wirtschaftliche Konflikte möglichst gewaltfrei und fair zu lösen. Andererseits ist alleine schon das Zustandekommen internationaler Vertragswerke bzw. die Einrichtung supranationaler Organisationen zu ihrer Überwachung und Weiterentwicklung immerhin Ausdruck einer fundamentalen weltpolitischen Einsicht, die unter anderem im Solidaritätsprinzip der Katholischen Soziallehre ihren Niederschlag gefunden hat.
Weit verbreiteten Missinterpretationen zum Trotz stellt Solidarität für die Katholische Soziallehre nämlich zunächst keine moralische Forderung dar, sondern vielmehr eine „Seins-Tatsache“, die auf einer Grundannahme über die menschliche Gesellschaft fußt: Demnach leben alle Menschen auf demselben begrenzten Planeten Erde und sind alleine schon aufgrund dieser Tatsache in irgendeiner Weise miteinander verbunden, voneinander abhängig – und füreinander verantwortlich. Die Menschheit muss folglich als umfassender Haftungsverbund begriffen werden, und auf Basis dieses Befundes kann es auf dieser Welt gar kein gutes Zusammenleben geben (im Sinne von gerecht, friedlich und dauerhaft), wenn nicht in einem solidarischen Ordnungsrahmen. Das ist auch der Grund, weshalb die weltkirchliche Sozialverkündigung (unbeschadet eines anderen ihrer Grundprinzipien: der Subsidiarität) angesichts zwischenstaatlicher Interessenskonflikte und anderer weltpolitischer Herausforderungen internationalen Regelwerken und supranationalen Zusammenschlüssen stets einen klaren Vorzug gegenüber lokal-, regional- oder nationalpolitischen Souveränitätsansprüchen und Handlungsoptionen gegeben und sich für deren institutionelle Stärkung und Weiterentwicklung eingesetzt hat.
Denn die bloße Feststellung der „faktischen“ Solidarität, dass also letztlich die gesamte Menschheit in einem Boot sitzt, sagt ja noch nichts über die Lebensverhältnisse der einzelnen „Passagiere“ und die moralische wie politische Qualität ihrer Beziehungen aus. In jedem Boot gibt es bekanntlich bessere und sichere Plätze ebenso wie prekäre und lebensbedrohliche. Und die Frage, wie die daraus sich ergebenden Konflikte und Herausforderungen gelöst werden, ist mit der bloßen Feststellung eines solidarischen Haftungsverbundes aller noch keineswegs ausreichend beantwortet.
Nimmt man den Solidaritätsbegriff der Katholischen Soziallehre jenseits aller emotionalen, ideologischen und moralischen Aufladung ernst in seiner ursprünglichen Bedeutung als „Seins-Prinzip“, dann ergibt die Rede von bzw. die Sorge und Klage über ein „Ende der Solidarität“ also zwar streng genommen keinen Sinn: Man kann ja nicht einfach „weg-reden“ bzw. zur Disposition stellen, was unvermeidlich und allem anderen voraus immer schon ist. Was allerdings zur Disposition bzw. infrage steht, ist die Tauglichkeit politischer Optionen, welche glauben, an der solidarischen Grundverfasstheit dieser Welt „vorbei-regieren“ zu können. Dass es davon zur Zeit mehr als genug gibt – von den kleingeistig-nationalistischen Exit-Bewegungen über egomanische „Wir-zuerst“-Populisten bis hin zur Neigung der militärischen und wirtschaftlichen Großmächte, überhaupt nur noch als „souverän“ anzuerkennen, wer imstande ist, seine Eigeninteressen durchzusetzen (egal mit welchen Mitteln) – das ist das weltpolitische Grundproblem der Gegenwart.
Aus dem Blickwinkel der Katholischen Soziallehre und ihres Solidaritätsbegriffs ist unsolidarische Politik also nicht nur unsachgemäß, sondern schlichtweg kurzsichtig, wenn nicht sogar dumm. Aber wie sagte bereits Ödön v. Horváth in entlarvender Hellsichtigkeit: „Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit.“
Dieser Artikel ist auch in QUART erschienen.
Zum Autor: Markus Schlagnitweit ist Direktor der ksœ.



