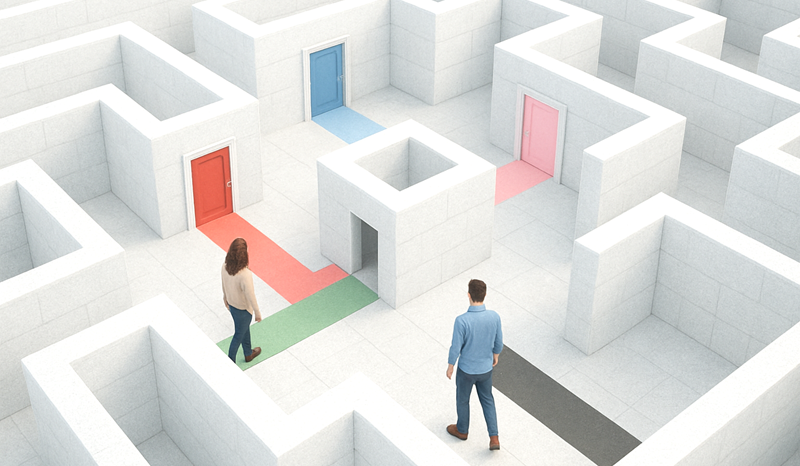Geleitet von sozialethischem Denken stellen wir uns gesellschaftlichen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit und verfolgen das Ziel, gesellschaftlichen Wandel im Sinne unserer Grundprinzipien Personalität, Gemeinwohl, Solidarität und Subsidiarität mitzugestalten. Unsere Hauptaufgaben bestehen dabei in der Forschungstätigkeit sowie im Dialog mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.